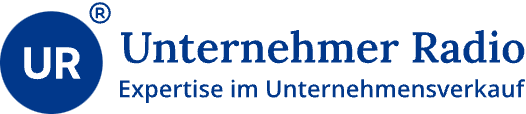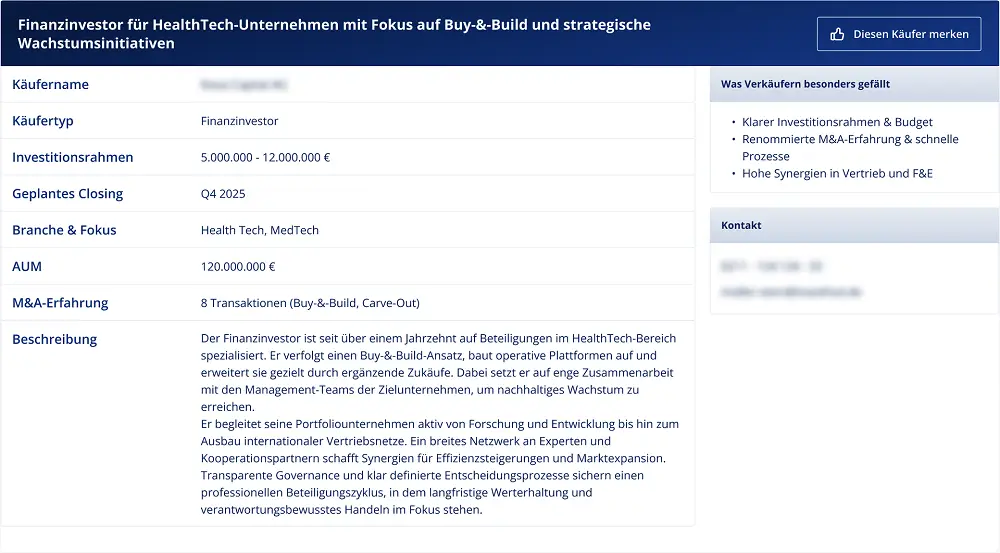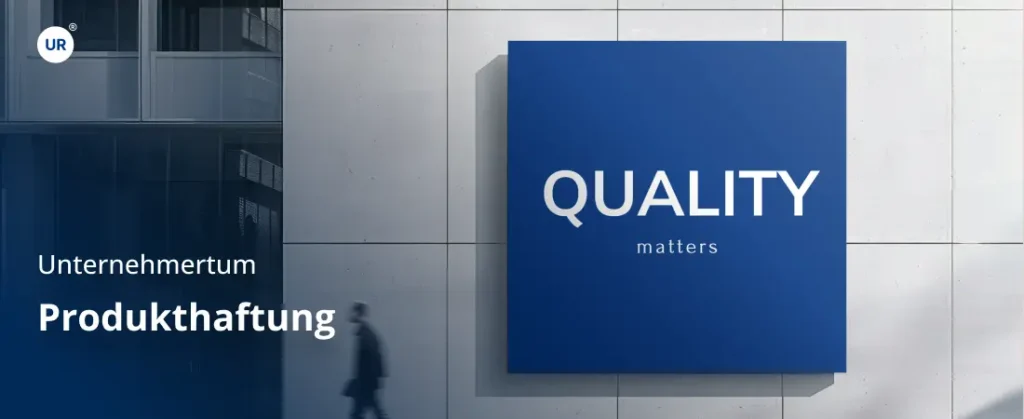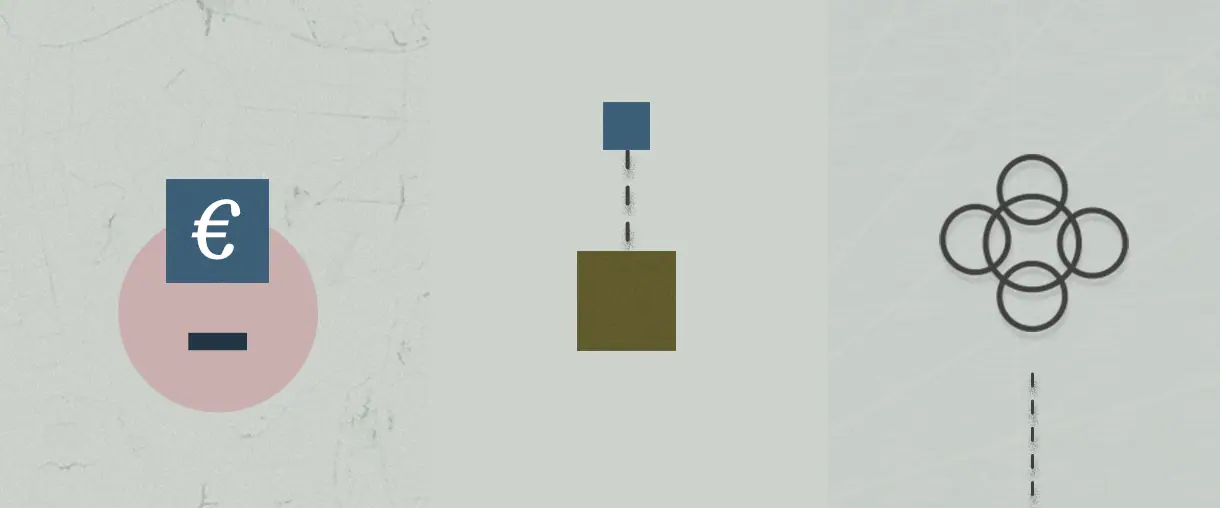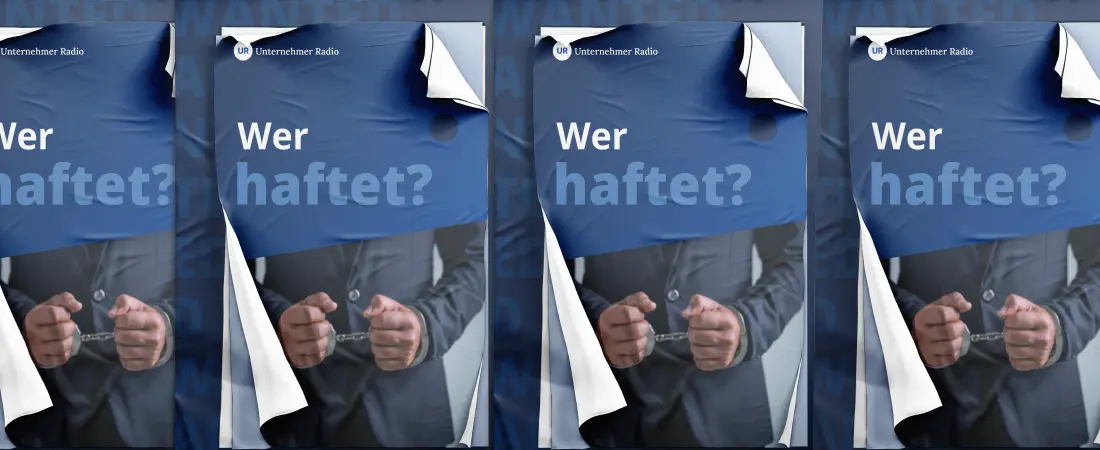Lesedauer: 12 Min.
Lesedauer: 12 Min.
Mit Schadstoffen kontaminiertes Kinderspielzeug, explodierende Airbags wegen fehlerhaften Treibmittels, brennende Akkus durch Überhitzung, platzende Autoreifen bei hohen Temperaturen, Softwarefehler in der Motorsteuerung. Die Liste der Schäden durch fehlerhafte Produkte ist lang, doch wie wird die Produkthaftung geregelt?
Wer ein Produkt herstellt oder in Umlauf bringt, ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass davon keine Gefahren bei der Verwendung ausgehen. Die Produkthaftung nach deutschem Recht behandelt die Frage, ob und inwieweit der Hersteller eines fehlerhaften Produkts für daraus resultierende Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die bei der Nutzung auftreten.
Das Wichtigste in Kürze
- Zwei gesetzliche Grundlagen: Die Produkthaftung in Deutschland basiert auf dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) und § 823 BGB. Beide regeln die Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte, unterscheiden sich jedoch in den Haftungsvoraussetzungen.
- Haftung auch ohne Verschulden: Nach dem Produkthaftungsgesetz haftet der Hersteller unabhängig von einem Verschulden. Entscheidend ist, dass das Produkt nicht die erwartete Sicherheit bietet und dadurch ein Schaden entsteht.
- Pflichten für Hersteller und Verkäufer: Hersteller und Verkäufer müssen die Produktsicherheit gewährleisten, ihre Produkte regelmäßig beobachten und Risiken vermeiden. Die Einhaltung des Produktsicherheitsrechts ist zentral, um Schadensersatzforderungen zu verhindern.
Produkthaftungsgesetz und Produzentenhaftung im Überblick
Das Produkthaftungsrecht bestimmt sich einerseits nach den Regelungen der Produzentenhaftung[1] (§ 823 Abs.1 BGB) als auch nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes[2] (ProdHaftG). Dabei handelt es sich um normative Bereiche mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen, die jeweils eigenständig bzw. nebeneinander bestehen. Die Haftung für Schäden durch fehlerhafte Medikamente richtet sich speziell nach dem Arzneimittelgesetz[3] (AMG).
Für Ansprüche gegen den Hersteller eines fehlerhaften Produktes kommen in Deutschland grundsätzlich folgende Haftungsgrundlagen in Betracht: Ein Produktfehler kann sowohl eine Haftung des Herstellers nach den Vorschriften des ProdHaftG als auch im Rahmen einer deliktischen Haftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 823 Abs.1 BGB – sog. Produzentenhaftung) rechtfertigen.
- § 823 Abs.1 BGB: Ansprüche aus der „deliktischen“ Produzentenhaftung setzen voraus, dass der Hersteller eine ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht schuldhaft verletzt. Danach ist ein Hersteller dazu, verpflichtet, alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um von seinen Produkten ausgehende Gefahren zu vermeiden. Seine Pflichtverletzung besteht beispielsweise darin, dass er fehlerhafte Waren in den Verkehr bringt, die nicht die Sicherheitsansprüche seiner Kunden entsprechen.
- ProdHaftG: Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen (§ 1 Abs.1 ProdHaftG).
Der Hersteller haftet für die Fehler seiner Ware. Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann (§ 3 ProdHaftG).
Der Hersteller ist grundsätzlich für Folgeschäden verantwortlich, die andere aus der Benutzung seiner fehlerhaften Produkte erleiden. Die Haftung nach dem ProdHaftG besteht unabhängig davon, ob der Hersteller den Produktfehler verschuldet hat. Daher ist es rechtlich unerheblich, ob der Produktfehler durch den Hersteller vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. Im juristischen Sprachgebrauch wird diese Art der Haftung auch als Gefährdungshaftung bezeichnet. Vor allem in diesem Punkt weicht diese Form der Haftung von der Produzentenhaftung ab.
Einen Überblick zu den Unterschieden zwischen den beiden Haftungsformen finden Sie in der tabellarischen Synopse am Ende dieses Beitrags.
Die Produkthaftung nach dem ProdHaftG
Seit 1990 gilt in Deutschland das ProdHaftG. Dieses Gesetz geht auf eine entsprechende EU-Richtlinie zurück und steht eigenständig neben der Produzentenhaftung des BGB, sodass in Streitfällen Ansprüche nach beiden Rechtsgrundlagen geprüft und angewendet werden können.
Kommt es infolge eines Produktfehlers zu einer rechtlichen Auseinandersetzung, können daraus Haftungsansprüche des Geschädigten abgeleitet werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen des ProdHaftG erfüllt sind.
An die Durchsetzbarkeit von Schadenersatzansprüchen aus Produkthaftung knüpft der Gesetzgeber zahlreiche Bedingungen. Soll der Fall vor Gericht entschieden werden, müssen aufseiten des Geschädigten die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein.
Voraussetzungen der Produkthaftung nach dem ProdHaftG
Fehler eines Produkts (mangelnde Sicherheit)
- Verletzung eines geschützten Rechtsguts (Leib, Leben, privat genutzte Sachen)
- Ursächlichkeit der Rechtsgutsverletzung für den Schaden
- Haftung des Herstellers
- Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen
- Einhaltung der Verjährungsfrist
- Haftungsanspruch ist nicht erloschen
Besondere Merkmale der Haftung nach dem ProdHaftG
- Verschulden nicht erforderlich
- Haftungsbegrenzung für Personenschäden
- Unbegrenzte Haftung für Sachschäden; aber: Selbstbeteiligung des Geschädigten
Welche Produkte werden durch das ProdHaftG erfasst?
Produkte nach der aktuellen Fassung des ProdHaftG sind alle beweglichen Sachen, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen oder unbeweglichen Sache bilden, sowie Elektrizität. Dazu zählen demnach auch solche beweglichen Sachen, die z.B. durch Einbau oder Weiterverarbeitung als Bestandteil in eine nicht bewegliche Sachen integriert werden.
„Bewegliche Sachen“ im Sinne des ProdHaftG sind beispielhaft:
| Verbrauchsgüter | Gebrauchsgüter | Energieversorgung |
| Lebens- und GenussmittelGetränkeKosmetische und Hygiene-ProduktNahrungsergänzungsmittelPflege- und ReinigungsmittelHaushaltschemikalien | Mobiliar und WohngegenständeKunstobjekteHaushaltsgeräte und -anlagenSpielzeugeFahrzeuge, Kfz-Teile, -ZubehörMaschinen, WerkzeugeElektronische Geräte und KomponentenSoftware auf DatenträgernMedizinische Geräte | ElektrizitätGasFernwärmeWasser |
In der bisherigen rechtlichen Praxis wurde das ProdHaftG auch bei Fehlern von Standardsoftware angewendet. Nach gegenwärtigem Recht ist strittig, ob und inwieweit Software darüber hinaus unter den Produktbegriff fällt. Diese Streitfrage wird nun vorläufig ‛expressis verbis‛ durch die aktuelle EU-Produkthaftungsrichtline geklärt.
Während nach derzeitigem Recht, mit Ausnahme von Elektrizität, ausschließlich physische Produkte durch die geplante Regelung erfasst sind, wird der Produktbegriff nach der neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie erweitert. Mit der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht der EU-Mitgliedsländer wird der Produktbegriff ausdrücklich auf digitale Produkte ausgeweitet. Danach sollen nach der rechtlichen Definition der EU-Richtlinie künftig auch Software und KI-Anwendungen ausdrücklich als Produkte gelten.
Lesen Sie hierzu die Ausführungen zur EU-Richtlinie, die bis Ende 2026 von den Mitgliedsländern umgesetzt werden muss. Informationen zu den Kernbereichen dieser Richtlinie finden Sie am Ende dieses Beitrags.
Keine Produkte im Sinne dieses Gesetzes sind unverarbeitete landwirtschaftliche Naturprodukte (aus Ackerbau, Tierzucht, Imkerei und Fischerei) sowie Jagderzeugnisse. Landwirtschaftliche Rohprodukte sind generell von der Produkthaftung befreit.
Explizit fallen Arzneimittel nicht unter das ProdHaftG. Haftungsfragen zu Produktfehlern regelt statt dessen das Arzneimittelgesetz (AMG).
Wann gilt ein Produkt als fehlerhaft?
Voraussetzung für Ansprüche nach dem ProdHaftG ist, dass ein fehlerhaftes Produkt vorliegt. Ein Produkt weist einen Fehler auf, wenn es nicht den Sicherheitserwartungen entspricht, die unter Berücksichtigung aller Umstände, berechtigterweise erwartet werden können (§ 3 Abs.1 ProdHaftG).
Eine Haftung des Herstellers erstreckt sich auch auf Fehler an Einzelstücken („Ausreißer“), die nicht vermeidbar sind.
Verletzung eines geschützten Rechtsguts
Voraussetzung für eine Haftung nach dem ProdHaftG ist, dass ein fehlerhaftes Produkt ursächlich für die Verletzung eines geschützten Rechtsguts ist. Die Rechtsgutverletzung wiederum ist der Grund für den eingetretenen Schaden. Als konkrete Rechtsgutverletzung werden im Gesetzeswortlaut Tötung, Körperverletzung und Sachbeschädigung definiert (§ 1 Abs.1 ProdHaftG).
Hinsichtlich eines erlittenen Sachschadens besteht für den Anspruch des Geschädigten auf Schadenersatz folgende Einschränkung:
der Schaden ist nicht an dem fehlerhaften Produkt selbst, sondern an einer anderen Sache entstanden, die andere Sache ist für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und wurde durch den Geschädigten überwiegend dazu verwendet.
Wer zeichnet für den Schaden verantwortlich?
Jeder Hersteller eines Produktes haftet für die Fehler seiner Produkte. Der Begriff „Hersteller“ im ProdHaftG wurde bewusst weit gefasst. Je nach Konstellation des jeweiligen Falles haften nicht nur die tatsächlichen Hersteller eines Produkts, sondern zusätzlich auch „Quasi-Hersteller“, Importeure sowie Händler unter den hier genannten Voraussetzungen.
Als Hersteller betätigt sich laut der gesetzlichen Definition (§ 4 Abs.1-3 ProdHaftG), wer:
- ein End-, Teilprodukt oder einen Grundstoff herstellt.
- sich durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidbaren Merkmals als „Quasi“-Hersteller ausgibt.
- ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des Mietkaufs oder einer anderen Form des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in den Europäischen Wirtschaftsraum* (EWR) einführt oder verbringt.
- als Lieferant oder Händler auftritt und ein Hersteller des Produkts nicht feststellbar und er innerhalb eines Monats nicht in der Lage ist, den Hersteller oder die Person namentlich zu benennen, die ihm das Produkt geliefert hat.
Dienstleister zählen nicht zu den Herstellern nach dem ProdHaftG. Um den Markenwert nicht nachhaltig zu beschädigen, sollten Fehler und Schäden am Produkt möglichst vermieden werden.
*EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen
Welche Ausnahmen bestehen von der Haftung des Herstellers nach dem ProdHaftG?
Eine Ersatzpflicht des Herstellers ist rechtlich ausgeschlossen (§ 1 Abs.2 ProdHaftG), wenn
- er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat,
- der für den Schaden ursächliche Fehler noch nicht vorlag, als der Hersteller es in den Verkehr brachte,
- er das Produkt weder für den Verkauf oder eine andere Form des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck hergestellt noch im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat,
- der Fehler darauf beruht, dass das Produkt in dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller es in den Verkehr brachte, der geltenden Rechtslage entsprochen hat,
- der Fehler in dem Zeitpunkt, zu dem der Hersteller das Produkt in den Verkehr brachte, nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht erkannt werden konnte.
Voraussetzungen der Produzentenhaftung nach § 823 Abs.1 BGB:
Die Regeln zur Produzentenhaftung nach BGB gelten für alle deutschen Hersteller von Produkten. Danach sind sie dazu verpflichtet, die Produkte auf mögliche Gefahren durch Fehler zu untersuchen, bevor sie auf dem Markt in Verkehr gebracht werden.
Zu prüfende Voraussetzungen für die Produzentenhaftung sind u.a.:
- Rechtsgutverletzung durch ein fehlerhaftes Produkt
- Folgeschaden
- Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht
- Haftungsbegründende Ursächlichkeit der Verletzungshandlung
- Verschulden des Herstellers (Unternehmen)
- Beweislast des Geschädigten
- Entlastung des Herstellers
Der Begriff des Herstellers entspricht nicht dem Herstellerbegriff nach dem ProdHaftG. Als Hersteller nach BGB haftet grundsätzlich das Unternehmen.
Die Frage, ob der Hersteller durch sein Verhalten ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten verletzt hat, erfolgt durch Prüfung auf Konstruktions-, Fabrikations-, Instruktions- und Produktbeobachtungsfehler.
Wesentliche Merkmale der Produzentenhaftung sind:
- Keine Haftungshöchstgrenze/-beschränkung
- Keine Selbstbeteiligung
- Keine gesetzlichen Haftungsausschlussgründe
Fallbeispiele für fehlerhafte Produkte
Die folgenden Fallbeispiele zeigen, wie unterschiedlich Produkthaftungsfälle ausgestaltet sein können und auf welcher rechtlichen Grundlage Gerichte über Schadensersatzansprüche entscheiden. Sie verdeutlichen zugleich, wie wichtig sorgfältige Qualitätskontrollen, klare Instruktionen und eine kontinuierliche Produktbeobachtung für Hersteller und Händler sind.
1. Produkthaftung für Instruktionsfehler:
Ein Instruktionsfehler liegt vor, wenn ein Produkt zwar technisch einwandfrei konstruiert und hergestellt wurde, der Hersteller es jedoch unterlässt, Warnhinweise, Anweisungen, Gebrauchsanleitungen oder sonstige Instruktionen zu geben. Der Hersteller muss eine sichere Nutzung des Produkts gewährleisten und ist daher verpflichtet, über mögliche Risiken unaufgefordert und umfassend zu aufzuklären.
Beispielfall: Im Jahr 2009 befasste sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Frage, ob ein Autokonzern für einen Schaden wegen der Fehlauslösung von zwei Seitenairbags in einem PKW zugunsten des betroffenen Kunden haften müsse. Die Richter entschieden, dass der Hersteller grundsätzlich verpflichtet sei, vor Gefahren zu warnen, die bei der Verwendung eines Produkts nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht vermeidbar oder dem Hersteller Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung nicht zumutbar sind. Das gelte sogar für Gefahren, die von Produkten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgehen können oder bei fehlerhafter Nutzung drohen, wenn sie nicht zum allgemeinen Gefahrenwissen des Benutzerkreises gehören (BGH, Urt. v. 16.06.2009, Az. VI ZR 107/08).
2. Produkthaftung für Konstruktionsfehler:
Ein Konstruktionsfehler liegt vor, wenn ein Produkt nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht sicher entwickelt und hergestellt wurde und insbesondere nicht den berechtigten Sicherheitserwartungen eines durchschnittlichen Benutzers entspricht. Ein solcher Fehler betrifft sämtliche Produkte einer einheitlich konstruierten Serie, die denselben Mangel aufweisen.
Sogenannte Entwicklungsfehler gehören jedoch nicht dazu, soweit sie für den Hersteller nicht erkennbar sind.
Beispielfall: Der Bundesgerichtshof (BGH) stufte das Produkt Elektrizität aufgrund der Überspannung in einem Rechtsstreit als fehlerhaft ein. Dieser Fehler habe Schäden an den Elektrogeräten und der Heizung verursacht. Der Netzbetreiber sei verpflichtet gewesen, Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten, so dass Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen einwandfrei betrieben werden konnten. Die Transformation auf eine andere Spannungsebene sei jedoch nicht in Form der sogenannten Niederspannung für die Netzanschlüsse geschehen. Das Gericht stellte fest, dass es sich bei dem beklagten Betreiber des Stromnetzes im konkreten Streitfall als Hersteller des Produkts Elektrizität anzusehen sei, so dass er für den eingetretenen Schaden haftbar gemacht werden könne (BGH, Urteil vom 25. Februar 2014 – VI ZR 144/13).
3. Produkthaftung für Fabrikationsfehler:
Ein Fabrikations- oder Produktionsfehler liegt vor, wenn ein einzelnes Produkt etwa durch Material-, Montage- oder Bedienungsfehler infolge eines Fehlers im Herstellungsprozess von den vorgesehenen Qualitätsstandards oder Planungsvorgaben zur Soll-Beschaffenheit abweicht. Allerdings haftet der Hersteller nicht für „Ausreißer“. Unter diesen Begriff fallen solche Fabrikationsfehler, die trotz aller zumutbaren Vorkehrungen unvermeidbar sind. Bei Ausreißer handelt es sich um einzelne Stücke, die sich auch durch Kontrollen nicht ausschließen lassen.
Beispielfall: Durch den Biss auf ein Fruchtgummi erlitt ein 44-jähriger Schäden an zwei Zähnen. Die beschädigten Zähne musste daher überkront werden. Der Grund dafür waren Fremdkörper, die sich in dem Fruchtgummi befanden. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschied, dass der Hersteller, ein bekannter Süßwarenhersteller, an den Geschädigten Schmerzensgeld zahlen sowie die Kosten der Zahnbehandlung erstatten müsse. Die Richter folgten damit dem Gutachten des Sachverständigen, wonach Partikel aus Putzmaterialien beim Herstellungsprozess in die Gelatine des Fruchtgummis gelangt waren.
(OLG Hamm, Urteil vom 23.05.2013 – Az. 21 U 64/12)
4. Produkthaftung für Produktbeobachtungsfehler:
Bringt ein Hersteller sein Produkt in den Verkehr, muss er es beobachten und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen treffen, durch die eine Gefährdung verhindert wird.
Ein Produktbeobachtungsfehler liegt vor, wenn der Hersteller es unterlässt, das Produkt fortwährend auf Mängel und Gefahren hin bei der Verwendung zu beobachten und darüber zu informieren. Die Produktbeobachtungspflicht trifft den Hersteller ab dem Zeitpunkt, an dem er sein Produkt in den Verkehr bringt.
Beispielfall: Bei einer Autobahnfahrt verunglückte ein Motorradfahrer bei Tempo 140-150 km/h tödlich. Dem Biker wurde eine am Motorrad angebrachte Lenkerverkleidung zum Verhängnis, die sich während der Fahrt durch eine abschüssige Kurve als instabil auf das Fahrverhalten erwies. Das Motorrad geriet ins Schleudern, woraufhin der Fahrer stürzte, und gegen den Stützpfeiler der Leitplanke prallte. Als Ursache für den Unfall erwies sich im vorliegenden Fall die Verkleidung, mit der das Motorrad durch eine externe Firma im Vorbesitz ausgestattet worden war.
Die Eltern des Unfallopfers klagten mit Erfolg gegen den Motorradhersteller und dessen deutscher Vertriebsgesellschaft auf Schadenersatz und Schmerzensgeld wegen Verletzung der Pflicht zur Beobachtung des Produkts. Der BGH urteilte, dass den Hersteller die Beobachtungspflicht treffe, um rechtzeitig Gefahren, die aus der Kombination seines Produkts mit Produkten anderer Hersteller entstehen können, aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken. Nach Ansicht der Richter seien daraus zusätzliche Instruktionspflichten herzuleiten. Sie warfen dem Motorradproduzenten und dessen deutscher Vertriebstochter vor, nicht rechtzeitig vor den Gefahren der Lenkerverkleidung gewarnt zu haben.
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 09.12.1986, Az. VI ZR 65/86)
Die neue EU-Produkthaftungsrichtlinie
Zum 08.12.2024 trat eine neue EU-Produkthaftungsrichtlinie mit nachfolgenden Änderungen bzw. Ergänzungen in Kraft. Wesentliche Inhalte der Richtlinie sind:
- Erweiterter Produktbegriff: Die Haftung wurde auf digitale Produkte ausgeweitet. Als Produkte gelten danach auch Software und Künstliche Intelligenz (KI).
- Digitale Dienste: Integrierte oder verbundene digitale Dienste wie etwa Sprachassistenten, werden ebenfalls durch die Richtlinie erfasst. Für deren Sicherheit sollen grundsätzlich die Hersteller verantwortlich sein.
- Neuer Fehlerbegriff: Produkte gelten künftig als fehlerhaft, wenn sie den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben nicht entsprechen oder bestimmte sicherheitsrelevante Anforderungen an die Cybersicherheit nicht erfüllen.
- Erweiterter Haftungskreis: Neben Herstellern und Importeuren werden auch Fulfilment-Dienstleister und Bevollmächtigte des Herstellers in die Haftung mit einbezogen.
- Wahrscheinlichkeitsvermutung: Der Geschädigte genügt seiner Beweispflicht, wenn er die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers oder Zusammenhangs behauptet.
Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die EU-Richtlinie bis spätestens zum 09. Dezember 2026 in nationales Recht zu transformieren.
Den gesamten Wortlaut der neuen Richtlinie finden Sie hier in einem pdf-Dokument.
Die Bundesregierung hat bereits einen Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Produkthaftungsrichtlinie vorgelegt. In einer Stellungnahme übt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) Kritik an der Gesetzesvorlage. Nach Ansicht des DIHK geht der Referentenentwurf materiell-rechtlich über die EU-rechtlichen Vorgaben hinaus, indem er den Anwendungsbereich über das erforderliche Maß hinaus ausweitet. Darüber hinaus bleibe er hinter den nach Unionsrecht vorgesehenen Möglichkeiten zurück.
Die DIHK befürchtet eine Verteuerung der in der Vorlage erfassten Produkte, dass im Ergebnis zu einer Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland innerhalb der EU führen könne. Die DIHK regt daher an, den Entwurf zur Prüfung einem Praxischeck durch das Bundesministerium für Digitales (BMDS) zu unterziehen.
Es bleibt abzuwarten, ob die Stellungnahme des DIHT zu einer Änderung des Referentenentwurfs führen wird.
Der Text des Referentenentwurfs zur Umsetzung der EU-Richtlinie ist hier abrufbar.
Wie unterscheiden sich Ansprüche aus Produkthaftung nach dem ProdHaftG von denen der Produzentenhaftung (§ 823 Abs. 1 BGB)?
Der grundsätzliche Unterschied besteht in der Art der Haftung: Das ProdHaftG regelt eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung, während § 823 Abs. 1 BGB eine verschuldensabhängige (deliktische) Haftung abbildet.
Das ProdHaftG behandelt Rechtsgutverletzung, die durch fehlerhafte Produkte verursacht werden. Nach der Produzentenhaftung wegen Verletzung von Verkehrssicherungspflichten werden unmittelbar Schäden an fehlerhaften Produkten reguliert.
Vergleichende Übersicht zu Produkthaftung
| Merkmal | Produkthaftung (ProdHaftG) | Produzentenhaftung (§ 823 Abs. 1 BGB) |
|---|---|---|
| Haftungsform* | Gefährdungshaftung (verschuldensunabhängig) | Deliktische Haftung (verschuldensabhängig) |
| Rechtsgrundlage | ProdHaftG (ProdHaftG) | § 823 Abs.1 BGB |
| Verschulden erforderlich? | Nein | Ja |
| Haftende Personen | Hersteller, Quasi-Hersteller, Importeur, Händler | Jeder Produzent (Hersteller, Zwischenhändler, Endverkäufer) |
| Haftungsgrund | Verletzung Rechtsgut | Verletzung Verkehrssicherungspflicht |
| Haftungsursache | Fehlerhaftes Produkt | Fehlerhaftes Produkt |
| Haftungsumfang | Personen-, Sachschäden (an privat genutzten Sachen), keine Vermögensschäden | sämtliche Schäden |
| Haftungsgrenze | max. 85 Mio. Euro (je Schadensereignis) | Nein |
| Beweislast Geschädigter | Produktfehler und Schaden | Pflichtverletzung, Verschulden und Schaden |
| Selbstbehalt | 500 Euro bei Sachschäden | Nein |
| Verjährung | 3 Jahre ab Kenntnis | 3 Jahre ab Kenntnis |
| Ausschlussfrist | 10 Jahre ab Inverkehrbringen | 30 Jahre ab Pflichtverletzung |
| Anwendungsbereich | Nur bewegliche Produkte | Alle Produkte und Dienstleistungen |
Fazit
Das Produkthaftungsgesetz bildet gemeinsam mit § 823 BGB die rechtlichen Grundlagen für Schadensersatzansprüche bei fehlerhaften Produkten. Hersteller und Verkäufer sind verpflichtet, ein hohes Maß an Produktsicherheit zu gewährleisten und die Anforderungen des Produktsicherheitsrechts einzuhalten. Kommt es zu Schäden durch ein mangelhaftes Produkt, kann der Geschädigte nach dem Produkthaftungsgesetz auch ohne Verschulden des Herstellers Ansprüche geltend machen.
Nach § 823 BGB greift die Haftung, wenn eine schuldhafte Pflichtverletzung vorliegt. Für Unternehmen bedeutet das: Sorgfalt bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb ist unerlässlich, um Haftungsrisiken zu vermeiden und die Sicherheit der Verbraucher dauerhaft zu gewährleisten.